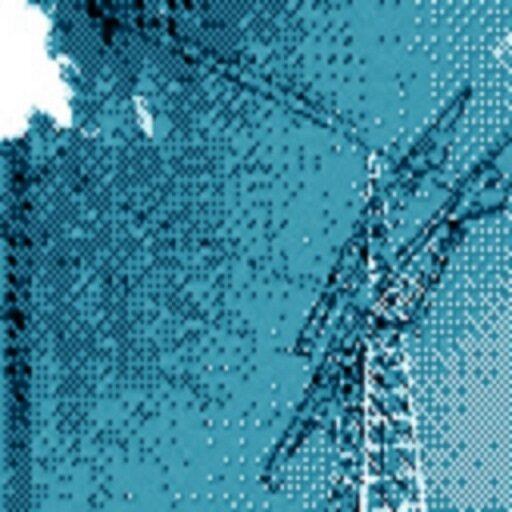„Was mich wirklich bewegt und erregt, schreibe ich ja doch nicht — vielleicht weil es sich schwer in Worte fassen lässt; vielleicht weil ich weiß, dass es nicht lohnt, dieses zum größten Teil unausgegorene Zeug in Worte zu fassen; vielleicht auch bin ich einfach zu faul, mich schriftlich auseinanderzusetzen mit einer Unmasse von Problemen – ziemlich politischer Art […].“
Brigitte Reimann, Ich bedaure nichts, S. 71.
Schreiben, um sich selbst zu begegnen. So oder so ähnlich hat das mal irgendwer in Worte gefasst. Und es ist wahr: im Schreibprozess findet eine Sortierung von Gedanken dergestalt statt, dass sie in irgendeiner Ordnung nach draußen dringen. Die eigene Persönlichkeit zieht aus dem Schreiben besonderen Nutzen. Einerseits zur Prüfung von Umfeld und Alltag. Andererseits, um (wichtige) Ereignisse festzuhalten, die wohl nach drei Wochen der Gefahr des ewigen Vergessens ausgesetzt sind. Gebannt wird alles in Tagebüchern. Nur wer Überlegungen anstellt, Geschehnisse reflektiert, Beziehungen auf den Grund geht und Position bezieht, kann gründlich über Leben, Ansichten und Gespräche berichten.
„[…] aber was sind schon Gespräche? Kaum mehr als Skizzen, eine Menge Makulatur; die Räume, ausgefüllt durch Gedanken, keine gefassten Vorstellungen des Sprechenden, bleiben für den Zuhörer leer, oder er ergänzt sie auf seine Weise.“ S. 334.
Ich ringe mit dem Stift… aber irgendwie auch nicht. Aufschreiben ist nicht das Problem, aber ist das wirklich der Schriebs, den ich haben will? Was will ich überhaupt? Festhalten. Erinnern. Wiedergeben. Leicht gesagt; beim Tagebuchvorhaben kann daraus schnell Zerdenken werden. Eher abträglich; unimpulsiv. Aber es fällt schwer, wirklich alle Hemmungen abzulegen. Mit Hemmungen meine ich Scham. Liest das nicht vielleicht doch mal jemand? Augen Dritter als Ausrede, die innere Ehrlichkeit durch Stift und Papier in die Realität zu überführen. Selbstverständliches Innenleben nachvollziehbar auszudrücken. Es fremdverständlich machen. Dann wäre mein Kopf lesbar – schwarz auf weiß – und nicht mehr im Gedankenversteck.
Unbehaglich, sich dieser blanken Nacktheit von Persönlichkeit und Empfindung zu stellen. Aber es lässt sich daran gewöhnen. Kopf wird Hand und Hand wird Schrift. Bleibt nur noch die Länge zu bestimmen, die ein Eintrag umfassen soll. Und die kann doll sein. Eine Beobachtung, ein Gefühl, eine Haltung. Was nur eine Sekunde durch den Kopf saust, kann auf dem Papier schnell mal in zwei Seiten Schrift ausarten.
„Übrigens merke ich einmal mehr, dass es unsinnig [ist], einem Tagebuch mehr zu erzählen als ein paar Fakten; ich bringe die Geduld nicht auf, meine Seele zu zerpflücken.“ S. 71.
Übrigens merke auch ich einmal mehr, dass mir oft die Geduld zum Selbstzerpflücken fehlt. Wie gut es sich währenddessen und danach anfühlt, spielt keine Rolle. Leider ist die tägliche Zeit beschränkt und es erfordert immer Überwindung am Ende festzuhalten, was vom Tage übrig blieb. Routiniertes Schreiben bedarf Hingabe. Die Verleitung zum sich-berieseln-lassen hingegen ist hoch. Immerhin gibt es genügend Angebote, die uns passiv und ohne Tätigwerden unterhalten. Christa Wolf hat in ihrem Essay „Tagebuch – Arbeitsmittel und Gedächtnis“ treffend formuliert:
„[Das Tagebuch] ist Vorarbeit, Halbfabrikat (deshalb so schwer zitierbar), aber es ist auch Arbeit, Training; Mittel, aktiv zu bleiben, der Versuchung des dahindämmernden Konsumierens zu widerstehen.“
Christa Wolf, Die Dimension des Autors, S. 21.
Auch geht sie auf die Relevanz von Tagebüchern für die Nachwelt ein. Neben persönlichen Befindlichkeiten werden meist Alltagsgeschehen und somit auch Gesellschaft, Land und (politische) Umstände in die Aufzeichnungen einfließen. Die Vergangenheit wird in Grenzen erfahrbar; wenigstens etwas greifbarer.
So viel zur Thematik. Um meine Schreiberei soll es nicht mehr gehen. Und Christa Wolf bietet eine wunderbare Überleitung zu Brigitte Reimann. Beide gehören wohl zu den berühmtesten Schriftstellerinnen der DDR. Die Tagebücher von Brigitte Reimann schlugen große Wellen. Neben ihren wichtigen Erzählungen und Romanen bilden sie einen ungeschonten Einblick in ihr Leben und Wirken. Sie spiegeln die Umstände in der DDR auf vielen Ebenen wider und lesen sich durch ihre großartige Erzählkunst und spannenden Inhalte unheimlich kurzweilig. Brigitte Reimann lebte ein intensives, leider sehr kurzes Leben – der bleibende Eindruck von ihr hallt bis heute nach.
Das Buch „Ich bedaure nichts“ ist der erste Teil von Brigitte Reimanns Tagebüchern. Es umfasst den Zeitraum von 1955 bis 1963. Der zweite Teil, „Alles schmeckt nach Abschied“, die Jahre 1964 bis 1970. Die Veröffentlichung fand nach ihrem Tod statt; einer solchen hat sie zu Lebzeiten nicht aktiv widersprochen, sie aber auch nicht angeordnet. Brigitte Reimann ist jung gestorben. Gerade einmal 39 Jahre zählt ihr Leben, als sie ihrer Krebskrankheit erliegt. Ihr Geburtsdatum ist der 21.07.1933.
Brigitte Reimann findet ihren Weg zur Schriftstellerin bereits mit unter zwanzig Jahren. Ab diesem Zeitpunkt schreibt und veröffentlicht sie Erzählungen, Romane, Hörspiele, Drehbücher, Zeitungsartikel und vieles mehr. Erwähnenswert ist zunächst ihr Kurzroman „Ankunft im Alltag“ von 1961. Die Literaturströmung der Ankunftsliteratur ist nach diesem benannt, was seine Tragweite bereits betont. Bei der Ankunftsliteratur handelt es sich um literarische Werke der DDR, in denen das Leben der sozialistischen Arbeiter:innen in den Mittelpunkt rückt.
Brigitte Reimann war Teil des „Bitterfelder Weges“, eine Vision der DDR-Regierung. Künstler:innen, insbesondere Schriftsteller:innen, sollen in Fabriken schuften, um den Geist der arbeitenden Schicht einzufangen und getreu abzubilden. Ziel war es, die Literatur mit propagandistischen Sprenkeln zu versehen. Es sollte mit Vollgas oder eben subtil angepriesen werden, wie atemberaubend erfüllend es ist von früh bis spät in engen Schächten, übertrieben lauten Fabrikhallen oder auf dreckigen Kippplätzen zu stehen und somit Befindlichkeit und Schlafrhythmus staatswirtschaftlicher Produktivität zu unterstellen. Die Romantisierung des sozialistischen Traums, von dem am Ende auch nur die ganz Großen profitierten. Offiziell heißt es, die Grenze von Kunst und Produktion soll überwunden werden und der arbeitende, sozialistische Mensch in der Mitte der Gegenwartsliteratur stehen. Walter Ulbricht ist zu zitieren:
„[…] dann habe ich den Schriftstellern gesagt: Liebe Freunde, wenn ihr nicht andere, enge, freundschaftliche, kameradschaftliche Beziehungen zu den Arbeitern, zu den Bauern und so weiter bekommt, dann werdet ihr keine großen Kunstwerke schaffen können.“
Anfang 1960 zieht es Brigitte Reimann also nach Hoyerswerda. Dort arbeitet sie ein Jahr im VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe (~ 15 Minuten von Hoy entfernt). Diese Stätte ist bis 1989 der größte Braunkohleveredelungsbetrieb der Welt. In Hoy wird dafür eine eigene Neustadt aufgezogen; die Bevölkerung wächst innerhalb weniger Jahre von 7700 auf 70.000 Menschen an. Der Staat lockt, ein neues Leben im Prototyp des am-wahr-werdenden sozialistischen Traumes zu beginnen.
Die Brigade von Brigitte Reimann ist eine der Rohrleger:innen und Schweißer:innen. B.R. arbeitet dort und sammelt nebenbei Inspiration für Figuren; außerdem leitet sie einen sogenannten „Zirkel schreibender Arbeiter“. Umgekehrt sollen unter der Fahne des Bitterfelder Weges auch Arbeiter:innen dazu ermutigt werden, ihre Ansichten und Erlebnisse festzuhalten. Das Motto „Greif zur Feder, Kumpel!“ ist Leitgedanke.
Als Ergebnis dessen erfreut sich „Ankunft im Alltag“ großer Beliebtheit. Brigitte Reimann erhält 1962 den Kunstpreis des FDGB (die nichtstaatliche Auszeichnung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes). Die tragenden Ideale von B.R. sind sozialistischer Natur. Doch die Realität bröckelt. Während in den oberen Riegen Unsummen an Geld für falsche Planungen und Fehlkalkulation flöten gehen, sieht sich die arbeitende Schicht einem eher tristen Leben gegenüber. Keine Kultur und keine Ausgleichsmöglichkeiten im hochgelobten Hoy (für die wenig Freizeit, die der Rhythmus der Schichtbusse erlaubt). Von den Materialengpässen mal ganz zu schweigen. Viele versehren sich, um „Pumpe“ reibungslos zu halten. Die obigen Vorgaben Lasten auf den Schultern der Arbeiter:innen und Werkleiter:innen. Hier stellt sich der Bitterfelder Weg selbst ein Bein: Anstatt literarische Verherrlichung zu erwirken, bekommen die Künstler:innen nun erst die schmutzige Situation der „tadellosen“ Zustände zu fassen.
Schon zu diesem Zeitpunkt durchblickt Brigitte Reimann das Sprachgebilde von Partei und Politik und gleicht es mit der Wirklichkeit ab; Unstimmigkeiten ausmachend. Davon fließt einiges in ihr Schreiben und „Ankunft im Alltag“. Die zum Teil schlechten Arbeitsbedingungen und bescheidenen Wohnverhältnisse werden angesprochen. Aber auch der auslaugende Zwist mit erhabenen Funktionären. Trotzdem sind Samthandschuhe angelegt. Ihr Anschluss an den sozialistischen Realismus und den Bitterfelder Weg ist nicht zu überlesen.
Deutlichere Worte lassen sich wiederum in ihren Tagebüchern finden. Die Einträge bestechen mit brutaler Ehrlichkeit und verdeutlichen immer wieder aufs Neue die unverrückbare Haltung von Brigitte Reimann. Sie schreibt ehrlich. Ihr Charakter liegt im Papier und scheint von den Seiten. Sie ist gewissenhaft. Leichtfüßig. „Taumelnd zwischen Optimismus und Depression“. Urteilend. Eingestehend. Besinnt und beobachtend. Nicht, dass sie je einen absoluten Bruch mit dem System einging. Sie bemerkt jedoch mit feinem Gespür die Sprachfehler ihrer Zeit und macht darauf aufmerksam; sich nie dafür zu schade, eine unliebsame Diskussion zu entfachen. Während sie im Schreibprozess von „Ankunft im Alltag“ noch frisch im Umfeld startet, bekommt sie darüber hinaus die tatsächliche Tragweite der Gesamtsituation zu spüren. Die DDR kapselt sich immer weiter vom Westen ab und beschneidet die Freiheit der eigenen Bürger:innen zunehmend. Im Kontext des Mauerbaus schreibt Brigitte Reimann:
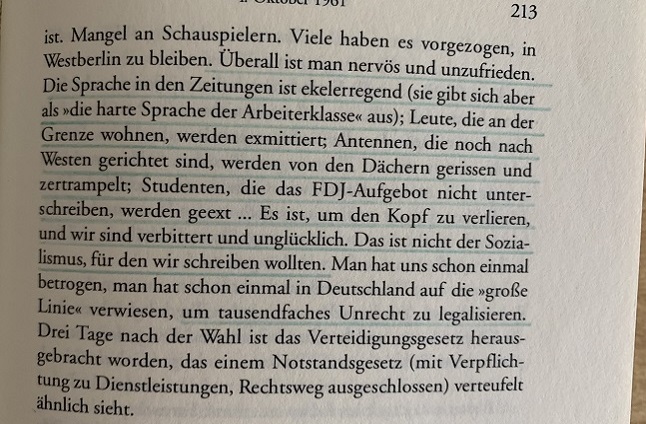
Vielleicht zum Hintergrund: Brigitte Reimann erlebte die repressive Zeit des Nationalsozialismus. Der Krieg hat auch sie gezeichnet. Die DDR galt als Gegenentwurf zur kapitalistischen, konservativen BRD. Hier sollte Kraft sozialistischer Staatsidee der freie, gleiche und wohlsituierte Mensch aufleben. Die junge Generation dieser Zeit hegt große Erwartungen an dieses Vorhaben. Ihre ausgemalten Ansprüche gipfeln in Lebensmut und Tatendrang; sie wollen die eingefahrenen Muster und Dogmen endgültig hinter sich lassen und nach dem schrecklichen Nationalsozialismus ein unbeschriebenes Blatt mit Erneuerung füllen. Den ganzen Dreck und Staub abgeschüttelt wissen. Dies war auch ein Grundpfeiler für Brigitte Reimann und ihr Platz in diesem Leben zu dieser Zeit: Schreiben, für die neue Idee! Nur sollte sich ihr Gesellschaftsverständnis zum Teil massiv von dem der Partei unterscheiden.
In ihrem nächsten Werk widmet sich Brigitte Reimann dem Konflikt zwischen DDR und BRD auf familiäre Weise. Ihr Bruder ist vor geraumer Zeit in den Westen gezogen; diese Erfahrung verarbeitet B.R. in der Erzählung „Die Geschwister“ von 1963. Spätestens hier lassen die Umstände auch ihren Arbeitsalltag nicht mehr kalt und der autoritäre Eingriff in ihr Schaffen beginnt:
„Das Manus mit den Änderungsvorschlägen ist zurückgekommen, die Stasi-Szene gestrichen, die Kunst-Diskussion gestrichen; alles, was an Gefühl oder gar – horrible dictu! – an Bett gemahnt, ist gestrichen, und jetzt kann man meine Geschichte getrost in jedem katholischen Mädchenpensionat auslegen.“ S. 248.
Doch Brigitte Reimann denkt nicht daran, ihren künstlerischen Ausdruck unter den miefigen Pantoffel des buckelnden Verlages zu stellen:
„Am Montag kommt der Lektor, der wird sich freuen. Wenn der Verlag starr bleibt, gehe ich zu einem anderen. Jetzt wird nicht mehr lamentiert, jetzt wird geboxt.“ S. 248.
Die Beschneidung des Inhalts konnte sie nicht komplett verhindern. Die Zensurbehörde schob Weltanschauungen zurecht und entfernte Anspielungen auf die Mangelwirtschaft. Sie erhielt für „Die Geschwister“ 1965 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR. Aber es gibt Neuigkeiten: 2022 werden Teile der handschriftlichen Urfassung und des Typoskripts bei Umbauarbeiten in ihrem alten Wohnhaus in Hoyerswerda gefunden. Hieran lässt sich die Zensur genau nachbilden, weshalb kurze Zeit später eine originalgetreue Neuauflage erscheint. Ein Beispiel für die Prüderie ist die Veränderung des Satzes „Du hast eine männermordende Taille.“ hin zu „Ich könnte deine Taille mit zwei Händen umfassen.“
Wenn Brigitte Reimann eines nicht war, dann prüde. In Hinblick auf ihr Liebesleben macht sie keine Abstriche aus Prinzipien heraus. Das Ehekonzept schnürt sie ein. Was nicht bedeutet, dass sie ihre Ehemänner nicht respektiert oder zu wenig Liebe für sie empfindet. Brigitte Reimann heiratet insgesamt viermal. Seit 1959 steht sie mit Siegfried Pitschmann (den sie Daniel nennt) in ihrer zweiten Ehe. Vor allem in diesem Zeitraum entstehen viele Seitensprünge und Dreiecksbeziehungen. Sie versteht ihr Verlangen und widersetzt sich dem nicht; unterdrückt sich nicht für ein Ideal fern ihres Anspruches an Sexualität, Liebe und Offenheit.
„Gleich als er mich ansprach und mich ansah, wusste ich, dass […] etwas geschehen würde, wusste es mit solcher Sicherheit, dass ich mir keine Mühe mehr gab, eine fremde Dame für ihn zu sein. Ich spüre sofort, wenn ein Mann mir gehören wird, und dann ist es gleichgültig wie er aussieht.“ S. 86.
„Meine Liebesgeschichten sind mir nur in den ersten drei Tagen interessant und im Grunde samt und sonders recht lächerlich. Ich hab mir auch das schlechte Gewissen abgewöhnt; Reue ist unter allen unnützen Gefühlen wahrscheinlich das allerunnützeste.“ S. 71.
Spoiler: Natürlich wird sie Reue empfinden. Ihre romantischen Beziehungen graben sich tief in ihr Leben und verlangen allerhand Ressourcen. Brigitte Reimann kann dadurch viel Kraft schöpfen; allerdings verzweifelt sie auch zunehmend in den Bredouillen, in die sie sich selbst manövriert.
„Sexuelle Hörigkeit ist mir stets als etwas Verächtliches und zugleich Süß-Gefährliches erschienen […]“ S. 323.
Eine intensive Affäre entwickelt sich zwischen ihr und Hans Kerschek (den sie Jon nennt). Hingabe und Zuneigung werden hier ab und an durch schlechtes Gewissen begleitet. So kommt es, dass sich diese Gefühle Bahn brechen und in kleineren und größeren Wutausbrüchen enden.
„[…] Einmal, in einem wilden Hassausbruch zwischen Kuss und Umarmung, würgte ich ihn und biss ihn bis aufs Blut. Er zerstört mein Leben, der Verfluchte.“ S. 236.
Ihrer Liebe zu Daniel bringt das keinen Abbruch – sie merkt jedoch auch die zunehmende Entfremdung. Das Leben mit B.R. versetzt ihm herbe Spuren. Auch ihr verlangt die Situation viel ab. Trotz allem ist in den Texten immer Aufopferungsbereitschaft und Ergebenheit zu spüren. Krisen schweißen zusammen, und so ist in dieser Turbulenz aus unberechenbaren Vorkommnissen vielleicht erst die Möglichkeit geboren, einen Menschen unabdinglich wertzuschätzen.
„Morgens im Bett, wenn er noch schläft, lege ich seinen Kopf an meine Schulter und küsse ihn und sage ihm alle die Zärtlichkeiten, die ich ihm tagsüber nicht sagen kann.“ S. 247.
Am folgenden Tag schreibt sie:
„Wenn ich nächstens zusammenbreche, wird es gründlich sein – aber ich bin entschlossen, nicht umzufallen, gerade jetzt nicht, da mich Daniel dringender braucht als sonst jemals.“ S. 247.
Beide ziehen dennoch einen Schlussstrich und lassen sich 1964 in Hoyerswerda scheiden. Siegfried Pitschmann wird aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Später wird Brigitte Reimann zum dritten Mal heiraten – und zwar …
Männliches Treiben fällt ihr in anderen Bereichen zunehmend lästig auf. Insbesondere Anmachversuche und Objektifizierungen ihres Körpers nennt Brigitte Reimann als unwürdige und unzählige Geschehnisse.
„Vielleicht entsetzt mich deshalb jedes mal wieder dieser Umschlag: ein Mann, der mich eben noch als gleichberechtigten Kollegen behandelt […] entdeckt auf einmal meine Brust und meine Hüften: die Schriftstellerin verwandelt sich für ihn, ist das Weibchen, das man besitzen will. Das ist: besessen werden von einem anderen, ihn zum Zeugen meiner Schwäche zu machen – das hasse ich. Ich bin ein Mensch wie sie, so gescheit und tüchtig und begabt wie sie, ich bin aber kein Objekt für ihre Gelüste.“ S. 286.
In der Szene der Schriftsteller:innen herrscht (wie in vielen Kunst- und Politikbereichen der DDR) eine männliche Dominanz. Sich hier als Frau durchzusetzen ist nicht leicht – ein Beispiel sind die oben erwähnten Diskreditierungsversuche, denen Männer nicht unterliegen aber die sie selbst nur zu gern anwenden.
Respektvolle Freundschaften auf Augenhöhe führt sie dennoch. Trotzdem ist es ermüdend, solche auszusieben „ […] in einem Land, in dem die Männer so wenig ritterlich sind wie bei uns.“ S. 324.
Hoyerswerda ist eine kleine Stadt. Brigitte Reimann führt einen heiteren Lebensstil. Keine gute Kombination in Hinblick auf Tratsch, Gerüchte und Sensationsgeschlachte; viele verklemmte Stinos stoßen sich an ihrer Art und Weise (weil sie vielleicht schmerzlich daran erinnert werden, dass es Erfüllung auch in Dingen abseits der gesellschaftlichen Norm geben kann). Neben ihrem Liebesleben war Brigitte Reimann auch eine trinkfeste Persönlichkeit. Vodka und Kognac hat sie förmlich veratmet. Außerdem raucht sie; das ist ja kein Problem, aber eine Zigarre? Das muss bei einer Dame doch nun wirklich nicht sein.. Ach, und letztens sah ich sie mit einer ganzen Batterie Vodkaflaschen zum Glasmüll marschieren.. Ja, und so wirkte auch ihr Gesicht.. Und dann rannte sie eines Nachts besoffen mit ihrer Affäre über den Spielplatz hier um‘s Eck.. Die sind sogar geschaukelt.. Unsere DDR-Literatur! Auf der Schaukel! Können Sie sich das vorstellen!?
„Und dann brach diese Stadt wieder über uns herein, mit ihren pedantischen Häuserzeilen, mit Klatsch und der provozierenden Dümmlichkeit der Funktionäre.“ S. 320.
Das Gequatsche von Bewohner:innen lässt sich vielleicht noch schmerzlich aushalten. Allerdings sind auch viele Funktionäre und „Genossen“ in dieses Gezeter involviert und nutzen jede Möglichkeit für eigene Vorteile.
„Diese Leute hier, dem Namen nach Genossen, klammern sich alle an ihre Posten, sie zittern um ihre Funktion und vor dem Schreckensgespenst Produktion, und sie beißen und schmieren nach allen Seiten, es wird einem übel von dem Schauspiel. Klägliche Provinz-Intriganten, die mit Lüge und Erpressungen arbeiten, um hochzukommen.“ S. 308.
Als die Moralapostel der Kreisleitung im Zuge ihres „ausschweifenden“ Lebensstils hellhörig werden und unter dem Deckmantel des Gesellschaftsanspruchs eine „Aussprache“ im Künstleraktiv fordern, „willigte ich freudig ein: unter der Bedingung, dass ich auf jeden einzelnen meiner Richter mit dem Finger deuten und seine Bettgeschichten erzählen dürfe… Meine Funktionäre verzichteten auf diese sensationelle Aussprache, sie wissen zu viel voneinander und fürchten, dass auch ich zu viel weiß […]“ S. 313.
Brigitte Reimann ist das Paradebeispiel einer emanzipierten Frau in der DDR, die sich den anfänglichen Aufschwung der Geschlechter im Zuge der sozialistischen Idee zu eigen macht und schließlich bis zu Ende denkt – und für sich durchsetzt. „[…] beim Thema Gleichberechtigung gehe ich auf die Barrikaden. Wenn ich schon „Würde der Frau“ höre – dieses auf-ein-Podest-heben ist nur eine feinere Art von Abwertung und Beiseiterücken.“ S. 340.
Gegenwind kommt aus der patriarchal organisierten Politik und Gesellschaft, der solche demokratie- und freiheitsstrebenden Frauen ein Dorn im Auge sind. Gesellschaftlich kann sie sich unter enormen Kraftaufwand wehren. Auf politischer Ebene gestaltet es sich schwieriger. B.R. hat indes Glück, da sie durch die Literatur eine gewisse Unabhängigkeit genießt. Andere Frauen, vor allem in Rundfunk und Presse, fielen unliebsamen Neubesetzungen zum Opfer. Hier von Ines Geipel zu den Anfängen der DDR auf den Punkt gebracht:
„[Strukturierungsversuche], die auf eine ambivalente Doppelstrategie der Ulbricht-Riege in Bezug auf die im Osten lebenden Frauen hinweisen: Zum einen folgt die Staatsmacht einem Bolschewisierungsmodell, einem orthodoxen marxistisch-patriarchalischen Konzept, das die Frauen als selbstbewussten, arbeitenden d.h. ökonomisch unabhängigen „Erbauer des Sozialismus“ braucht und ihnen jenseits ihrer konventionellen Rollen unweigerlich Eigenständigkeit zugestehen muss. Diese Strategie sollte sich deutlich von der an den Herd zurückfordernden Frauenpolitik als Mütterpolitik im Westen abheben und führte unbezweifelbar über die ökonomische Unabhängigkeit zu vielfachen eigenwilligen weiblichen Lebensentwürfen. Zum anderen muss dieses kreative Potential immerzu diszipliniert werden. Gerade auch wegen der Erfahrungen von Frauen bei der selbstständigen Organisation von Leben in der Zeit des Krieges werden sie als vehement demokratiefordernde Kraft eingeschätzt und gelten für das sich hierarchisch und polar gründende DDR-System als potenzielle Gefahr.“
Ines Geipel, Die Welt ist eine Schachtel, S. 81.
Brigitte Reimann kann auch von ihrer Berühmtheit zehren. Das öffentliche Ansehen legt sich wie ein labiler Schutzmantel um sie; es war nicht leicht zu rechtfertigen, eine gefeierte Autorin willkürlich zu sanktionieren. Wenn es den Willen gab, gelang aber auch das in der DDR.
Nichtsdestotrotz wurde sie bespitzelt und von der Staatssicherheit überwacht. Eingriffe kommen von allen Seiten:
„Schon wieder Ärger mit der DEFA, das Treatment soll umgeschmissen werden, irgendwelche künstlerischen Beiräte pfuschen mir in die Arbeit.“ S. 249
Die Kulturpolitik des Landes erzürnt Brigitte Reimann zunehmend. Ihren Unmut lässt sie die Verantwortlichen manchmal spüren. Walter Ulbrichts Festschrift verpasst sie eine Absage: Für Walter Ulbrichts 70. Geburtstag ist ein Buchband geplant. Viele wichtige Repräsentant:innen der DDR sollen darin zu Wort kommen und ihm Agavendicksaft ums graubärtige Maul schmieren. Ein Text von Brigitte Reimann darf in dieser Gewäschsammlung natürlich nicht fehlen. Sie wurde des Öfteren von Vertretern um ihren Beitrag gebeten. Aber sie so: Bro, auf aller gar keinsten:
„Er wollte mich für eine Ulbricht-Hymne gewinnen […] aber ich habe abgelehnt. Unmöglich für einen Menschen mit Verstand, über U. als den Förderer der schönen Künste zu schwatzen.“ S.246.
Natürlich behielt sie recht. Nur wenige Monate später schreibt sie folgendes über eine Rede Ulbrichts, der sie (wie viele andere Schriftsteller:innen) im Plenarsaal beiwohnte:
„Es ist hoffnungslos, Besserung für unsere literarische Situation zu erwarten, solange dieser amusische Mensch mit seinem Kleinbürgergeschmack sich Urteile anmaßt.“
Und dann weiter:
„Das Schlusswort war entsetzlich, schließlich brach ich in Tränen aus vor Wut und Hass gegen diesen Mann, der die Künstler in der gemeinsten Weise beschimpfte […]“
Daraus folgert sie: „Er kann uns nicht leiden – vielleicht glaubt er, wir haben als Propagandisten versagt.“ S.268.
Diese und andere Situationen entfernen sie immer weiter von den Regierungsidealen. Die Kulturpolitik lässt mit den Debatten über Kunst ihren Kopf zerbrechen. Die staatliche Umsetzung indes zermürbt auf personalpolitischer Ebene. Schleimiges Gehabe und Duckmäusertum wittert Brigitte Reimann drei Kilometer gegen den mit Abgasen durchsetzten Wind.
„ich […] fühle mich immer für jemanden verantwortlich und errege mich über all das Unrecht, das um mich geschieht, über das, was mir getan wird, ich hasse das Ausmaß an Dummheit, zu dem unsere Funktionäre fähig sind, und wenn ich mit ihnen über Kunst sprechen muss, leide ich physisch.“ S. 307.
Aber Frau Reimann, haben Sie denn gar kein Vertrauen in unsere Partei? Die SED als sozialistisches Wunderwerk wird unsere DDR an die Spitze führen. Wir erleben gerade den- „Vertrauen zur Partei? […] Zu unseren Genossen hier habe ich jedenfalls kein Vertrauen, und ich werde nicht aufhören mich herumzuraufen, und irgendwann geht der Laden hier hoch – falls sie nicht vorher einen Dreh gefunden haben, mich fertigzumachen.“ S. 306
Für sich zieht sie die Schlussfolgerung, sie sei „eine Parteilose und also nur ein halber Mensch.“ S. 306.
Das autoritäre Auftreten des Staates lassen furchtbare Erinnerungen hochschnellen. Sie rechnet mit Parallelen zum Nationalsozialismus gnadenlos ab.
„Wir hassen den Militarismus in der Republik, dieses unausrottbare Preußentum und seine militante Sprache […], und ich fand mich bestätigt, dass ich auch aus seinem Munde das Urteil „faschistisch“ hörte für gewisse Erscheinungen […]“.
Die Erscheinungen zählt sie auf: Moderne Malerei als entartete Kunst, rassistische Verurteilung der Jazz-Musik, die deutsche Arbeitskraft als beste der Welt, propagandistische Pressesprache … Wegen dieser Zustände lautet ihr vernichtend nüchternes Urteil: „Alles wie gehabt.“ S. 265
Auch eine Pionierdelegation ruft bei ihr und anderen Kolleg:innen schiere Übelkeit hervor. Paraden, Fahnen, Indoktrinierung Jugendlicher, Personenkult, Marschtritt … Das totgeglaubte Schreckensgespenst kehrt langsam unter Hammer und Zirkel zurück.
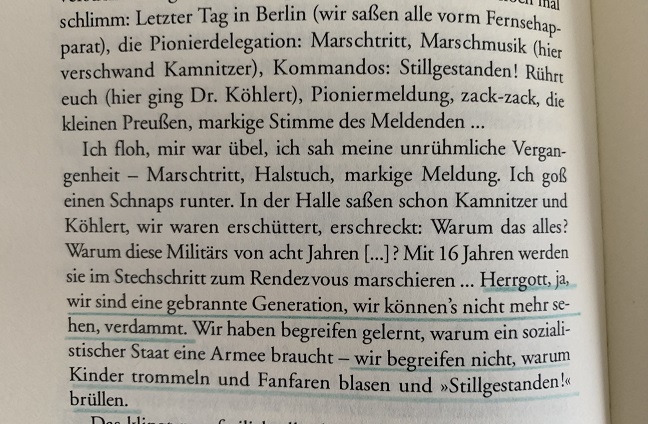
Schließlich ist die Rede auf den letzten Roman von Brigitte Reimann zu lenken. An „Franziska Linkerhand“ schreibt sie über zehn Jahre. Leider bleibt es Romanfragment. Bevor sie die Geschichte beenden kann, geschieht ihr Ableben. Obwohl sie die letzten Seiten unter schwerster körperlicher Beeinträchtigung verfasst, fehlen laut ihrer Angabe rund 50 Stück zur Komplettierung. Die Veröffentlichung findet dann postum im Jahr 1974 statt; natürlich zensiert. Eine ungekürzte Neuausgabe erscheint 1998.
„Franziska Linkerhand“ wird als ihr Opus Magnum gehandelt. Es wird anhand der Geschichte deutlich, dass Hoyerswerda samt politischer Situation und die Arbeitsbedingungen als Schriftstellerin sie bis zuletzt beschäftigten. Die Heldin ist Architektin; diese Tatsache entspringt dem entflammten Interesse Brigitte Reimanns an Architektur und Städtebau. Den Stoff beschreibt sie wie folgt:
„Franziska ist keine „Schlacht unterwegs“-Heldin; sie kommt voll strahlender Pläne in diese Stadt, in der man nichts verlangt als nüchternes Rechnen, schnelles und billiges Bauen. Kein Platz für persönlichen Ehrgeiz – eine Namenlose in einem Kollektiv, dessen Heldentum darin besteht, dass man nach langem Tüfteln an der Korridorwand drei Zoll einspart.“ S. 360.
Die Parallelen zu Hoyerswerda sind unübersehbar. Doch nicht nur das treibt die Romanidee um. Neben der vertrackten Arbeits- und Identitätsfrage wird aufgeworfen „wohin sind am Ende die leidenschaftlichen Entwürfe der Jugend?“. Und neben der Erkenntnis, die Welt nicht aus den Angeln gehoben zu haben, scheint auch das emotionale Dasein als empfindsames und bedürftiges Wesen auf der Strecke zu bleiben:
„Wo ist die flammende Liebe? Erstickt in einer konventionellen Ehe, im gemeinsamen Badezimmer, zwischen Wäsche waschen, Fernsehen und dem „was essen wir morgen?“ S. 360.
Vor allem der Spagat zwischen effektiven und billigen Baumethoden und der realen Lebensatmosphäre inmitten trister Neubauschluchten fasziniert Brigitte Reimann. Hier läuft in der DDR wenig rund, was ihren gedanklichen Spielraum zur wahren „Musterstadt“ entfesselt. Hoyerswerda verlässt sie im Jahre 1968 und zieht nach Neubrandenburg. Dort schreibt sie auch an „Franziska“ weiter, wie sie das Werk nennt. Die Verkettung mit Hoy bleibt ihr auf nachdrückliche Weise erhalten.
In „Franziska Linkerhand“ spiegeln sich viele ihrer Lebenserfahrungen wider. Für sich beschloss sie, alles auf ungeschonte Weise aufzuschreiben; sich nicht länger anzubiedern. Schon früher fragte sie sich: „Ist es immer noch so schwierig bei uns, mutig zu sein? Wovor scheuen die anderen Schriftsteller zurück?“ S. 261.
Mit „Franziska Linkerhand“ schreibt Brigitte Reimann das Buch, welches über Jahre hinweg lose vor ihrem inneren Auge schwebte. Es ist in vielerlei Hinsicht erwachsener und gereifter als ihre vorherigen Werke; sowohl was Thematik als auch Stil betrifft.
In anderer Dimension verbleiben ihre Tagebücher. Sie unterstreichen ihre Kunstwerke und setzen diese in persönlichen Kontext. Ihr Handeln wird in Grenzen erfahrbar und die Umstände zu dieser Zeit etwas greifbarer. Brigitte Reimann hinterlässt ein intimes schriftliches Abbild ihrer selbst und der damaligen Lebenssituation. Aufrichtig und detailliert. Und dabei ist sie verdammt witzig. Mit einer herrlichen Schandschnauze. Aber auch angepisst. Auf Wolken laufend. Am Boden zerstört. Mal jede Hoffnung greifend; mal lebensmüde. Verpatzt. Versteht. Nie sinnentleert. Liebevoll. Stets strebsam. An ihre Mitmenschen denkend. Sie kann unfair behandeln. Sie will ein besserer Mensch sein. Sie ist selten so richtig zufrieden. Sie lässt sich nicht unterkriegen.
Sie hat ihren Traum erfüllt, eine bedeutende Schriftstellerin zu werden. Und noch so vieles mehr.
„Als ich den Weg zurückging, durch die Gärten, unter der Sonne, den Mantel offen, hatte ich diesen vertrackten, ganz körperlichen Schmerz in der Brust, den ich kenne, und der zum Glücklichsein dazugehört. Aber er war nicht eingeplant. Manchmal denke ich darüber nach, wie oft ich geliebt habe, wie oft ich geliebt wurde, ich habe ein wunderschönes Leben, ich bedaure nichts.“ S. 261.
BRIGITTE REIMANN • TAGEBÜCHER • 1997 • 428 Seiten • Aufbau Verlag